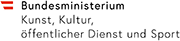Rainer Metzger,
3. Oktober
Bei den Deutschen ist Nationalfeiertag. Fragen wir doch, ob man das ihrer zeitgenössischen Kunst ansieht.
Natürlich ist es müßig, den Arbeiten der aktuellen Gegenwart irgendein Charakteristikum aufzuerlegen, das ihnen essentiell wäre, weil sie aus Deutschland kommen. Doch wer dazu disponiert ist, kann ihnen das Deutsche anmerken, nicht als Wesen oder Wahrheit, aber als Spur und Markierung. Schließlich sind es immer bestimmte Situationen, Milieus, Atmosphären, die Orte unverwechselbar machen. Viererlei Bedingungen wären es vielleicht, die man diesem spezifischen Ort deutsche Kunst anmerken könnte.
 Hans Haake, Der Bevölkerung, Installation, Deutscher Bundestag © Bildrecht, Wien 2014
Das Deutsche als Topos: Man hat den Deutschen ihre Musik gutgeschrieben, ihre Philosophie und irgendwann in den siebziger Jahren sogar ihren Film; nun wäre die bildende Kunst an der Reihe oder, besser gesagt, „die Kunst“ im Singular, die ihrerseits Produkt der Deutschen ist, und noch dazu der Romantik, der nationalen Epoche schlechthin.
Die NS-Vergangenheit: Die Deutschen werden diese Schlagseite nicht los, die sie selbst in die Weltgeschichte getragen haben. Harry Mulisch, der holländische Schriftsteller, hat mit „Die Zukunft von gestern“ ein Buch über einen nicht geschriebenen Nazi-Roman verfasst. Er erzählt darin unter anderem von seinem Besuch der Wagner-Festspiele in Bayreuth im Jahr 1971. Mulisch und seine Clique waren etwas derangiert dahergekommen, und sie wurden nun von den übrigen Besuchern taxiert. Was heißt taxiert, sie wurden, wie Mulisch die Klimax offenbar für opportun hält, „hochmütig gemustert und mit Blicken getötet, niedergeschossen, aufgehängt, vergast, weil wir unsere Krawatten abgenommen haben“. Jeder kennt als Deutscher derlei Aufzählungen, die Aufrechnungen sind und in denen der Aufrechnende sich selbst für ebenso verwegen hält wie die Aufgerechneten für die Bösen.
Die Großstadt Berlin: Deutschland hat wieder eine Kapitale, die den Namen verdient, und es ist sicher kein Zufall, dass die Konjunktur des Deutschen in der globalisierten Kunst mit dem (Wieder-)Aufstieg Berlins und seiner erneuerten Sogwirkung zusammenfällt. Berlin hat in den Zwanzigern gesehen, wie prekär Glanzzeiten sind, seine Kultur hat das Wissen um die Gefährdetheit stets wachgehalten, und das traurigste Ende, das jemals eingetreten ist, hat es gleich mitgeliefert. Das latent Katastrophische auch der Gegenwart ist in Berlin ganz bei sich.
Das Institutionelle: Vielleicht hat Deutschland bzw. die deutschprachige Hemisphäre mehr Opernhäuser als der Rest der Welt zusammen. Doch der deutsche Föderalismus, die vielgescholtene, jeder Metropole widerspenstige Kleinstaaterei, hat auch in der Bildenden Kunst vieles parat: Die Parallelität städtischer und staatlicher Häuser in vielen Orten zum Beispiel, das Lenbachhaus und die Pinakotheken in München, die Kunsthalle und K 20 bzw. K 21 in Düsseldorf, das Kunstmuseum und die Staatsgalerie in Stuttgart; oder die alten Kunstvereine und die Neugründungen aus dem Geist der 68er Revolte wie in Hannover; überhaupt das Prinzip Sezessionismus mit seiner Politik der Abspaltung, die immer neue Institutionen zu den selbstverständlich weiter existierenden alten fügt; schließlich insgesamt die Konkurrenz der Kommunen und Länder um Akademien, Szenen, Einflussbereiche, um Messen und Märkte.
Das Deutsche in der Kunst ist längst ein Kalkül; eine Koketterie mit der Interessantheit; die Engführung dessen, was es alles gibt, auf eine bestimmte Situation hin; die Aufladung des Alltäglichen mit dem Prekären; ein Kurzschließen des selbstverständlich Internationalen mit dem willkürlich Nationalen. Niemand ist angehalten heutzutage, das Deutsche zum Thema zu machen, doch wenn man es auffaltet, dieses ambivalente Ambiente, dann hat man zumindest mit einem Fluidum zu rechnen: mit der Ungebrochenheit der Gebrochenheit.
Hans Haake, Der Bevölkerung, Installation, Deutscher Bundestag © Bildrecht, Wien 2014
Das Deutsche als Topos: Man hat den Deutschen ihre Musik gutgeschrieben, ihre Philosophie und irgendwann in den siebziger Jahren sogar ihren Film; nun wäre die bildende Kunst an der Reihe oder, besser gesagt, „die Kunst“ im Singular, die ihrerseits Produkt der Deutschen ist, und noch dazu der Romantik, der nationalen Epoche schlechthin.
Die NS-Vergangenheit: Die Deutschen werden diese Schlagseite nicht los, die sie selbst in die Weltgeschichte getragen haben. Harry Mulisch, der holländische Schriftsteller, hat mit „Die Zukunft von gestern“ ein Buch über einen nicht geschriebenen Nazi-Roman verfasst. Er erzählt darin unter anderem von seinem Besuch der Wagner-Festspiele in Bayreuth im Jahr 1971. Mulisch und seine Clique waren etwas derangiert dahergekommen, und sie wurden nun von den übrigen Besuchern taxiert. Was heißt taxiert, sie wurden, wie Mulisch die Klimax offenbar für opportun hält, „hochmütig gemustert und mit Blicken getötet, niedergeschossen, aufgehängt, vergast, weil wir unsere Krawatten abgenommen haben“. Jeder kennt als Deutscher derlei Aufzählungen, die Aufrechnungen sind und in denen der Aufrechnende sich selbst für ebenso verwegen hält wie die Aufgerechneten für die Bösen.
Die Großstadt Berlin: Deutschland hat wieder eine Kapitale, die den Namen verdient, und es ist sicher kein Zufall, dass die Konjunktur des Deutschen in der globalisierten Kunst mit dem (Wieder-)Aufstieg Berlins und seiner erneuerten Sogwirkung zusammenfällt. Berlin hat in den Zwanzigern gesehen, wie prekär Glanzzeiten sind, seine Kultur hat das Wissen um die Gefährdetheit stets wachgehalten, und das traurigste Ende, das jemals eingetreten ist, hat es gleich mitgeliefert. Das latent Katastrophische auch der Gegenwart ist in Berlin ganz bei sich.
Das Institutionelle: Vielleicht hat Deutschland bzw. die deutschprachige Hemisphäre mehr Opernhäuser als der Rest der Welt zusammen. Doch der deutsche Föderalismus, die vielgescholtene, jeder Metropole widerspenstige Kleinstaaterei, hat auch in der Bildenden Kunst vieles parat: Die Parallelität städtischer und staatlicher Häuser in vielen Orten zum Beispiel, das Lenbachhaus und die Pinakotheken in München, die Kunsthalle und K 20 bzw. K 21 in Düsseldorf, das Kunstmuseum und die Staatsgalerie in Stuttgart; oder die alten Kunstvereine und die Neugründungen aus dem Geist der 68er Revolte wie in Hannover; überhaupt das Prinzip Sezessionismus mit seiner Politik der Abspaltung, die immer neue Institutionen zu den selbstverständlich weiter existierenden alten fügt; schließlich insgesamt die Konkurrenz der Kommunen und Länder um Akademien, Szenen, Einflussbereiche, um Messen und Märkte.
Das Deutsche in der Kunst ist längst ein Kalkül; eine Koketterie mit der Interessantheit; die Engführung dessen, was es alles gibt, auf eine bestimmte Situation hin; die Aufladung des Alltäglichen mit dem Prekären; ein Kurzschließen des selbstverständlich Internationalen mit dem willkürlich Nationalen. Niemand ist angehalten heutzutage, das Deutsche zum Thema zu machen, doch wenn man es auffaltet, dieses ambivalente Ambiente, dann hat man zumindest mit einem Fluidum zu rechnen: mit der Ungebrochenheit der Gebrochenheit.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger
 Hans Haake, Der Bevölkerung, Installation, Deutscher Bundestag © Bildrecht, Wien 2014
Das Deutsche als Topos: Man hat den Deutschen ihre Musik gutgeschrieben, ihre Philosophie und irgendwann in den siebziger Jahren sogar ihren Film; nun wäre die bildende Kunst an der Reihe oder, besser gesagt, „die Kunst“ im Singular, die ihrerseits Produkt der Deutschen ist, und noch dazu der Romantik, der nationalen Epoche schlechthin.
Die NS-Vergangenheit: Die Deutschen werden diese Schlagseite nicht los, die sie selbst in die Weltgeschichte getragen haben. Harry Mulisch, der holländische Schriftsteller, hat mit „Die Zukunft von gestern“ ein Buch über einen nicht geschriebenen Nazi-Roman verfasst. Er erzählt darin unter anderem von seinem Besuch der Wagner-Festspiele in Bayreuth im Jahr 1971. Mulisch und seine Clique waren etwas derangiert dahergekommen, und sie wurden nun von den übrigen Besuchern taxiert. Was heißt taxiert, sie wurden, wie Mulisch die Klimax offenbar für opportun hält, „hochmütig gemustert und mit Blicken getötet, niedergeschossen, aufgehängt, vergast, weil wir unsere Krawatten abgenommen haben“. Jeder kennt als Deutscher derlei Aufzählungen, die Aufrechnungen sind und in denen der Aufrechnende sich selbst für ebenso verwegen hält wie die Aufgerechneten für die Bösen.
Die Großstadt Berlin: Deutschland hat wieder eine Kapitale, die den Namen verdient, und es ist sicher kein Zufall, dass die Konjunktur des Deutschen in der globalisierten Kunst mit dem (Wieder-)Aufstieg Berlins und seiner erneuerten Sogwirkung zusammenfällt. Berlin hat in den Zwanzigern gesehen, wie prekär Glanzzeiten sind, seine Kultur hat das Wissen um die Gefährdetheit stets wachgehalten, und das traurigste Ende, das jemals eingetreten ist, hat es gleich mitgeliefert. Das latent Katastrophische auch der Gegenwart ist in Berlin ganz bei sich.
Das Institutionelle: Vielleicht hat Deutschland bzw. die deutschprachige Hemisphäre mehr Opernhäuser als der Rest der Welt zusammen. Doch der deutsche Föderalismus, die vielgescholtene, jeder Metropole widerspenstige Kleinstaaterei, hat auch in der Bildenden Kunst vieles parat: Die Parallelität städtischer und staatlicher Häuser in vielen Orten zum Beispiel, das Lenbachhaus und die Pinakotheken in München, die Kunsthalle und K 20 bzw. K 21 in Düsseldorf, das Kunstmuseum und die Staatsgalerie in Stuttgart; oder die alten Kunstvereine und die Neugründungen aus dem Geist der 68er Revolte wie in Hannover; überhaupt das Prinzip Sezessionismus mit seiner Politik der Abspaltung, die immer neue Institutionen zu den selbstverständlich weiter existierenden alten fügt; schließlich insgesamt die Konkurrenz der Kommunen und Länder um Akademien, Szenen, Einflussbereiche, um Messen und Märkte.
Das Deutsche in der Kunst ist längst ein Kalkül; eine Koketterie mit der Interessantheit; die Engführung dessen, was es alles gibt, auf eine bestimmte Situation hin; die Aufladung des Alltäglichen mit dem Prekären; ein Kurzschließen des selbstverständlich Internationalen mit dem willkürlich Nationalen. Niemand ist angehalten heutzutage, das Deutsche zum Thema zu machen, doch wenn man es auffaltet, dieses ambivalente Ambiente, dann hat man zumindest mit einem Fluidum zu rechnen: mit der Ungebrochenheit der Gebrochenheit.
Hans Haake, Der Bevölkerung, Installation, Deutscher Bundestag © Bildrecht, Wien 2014
Das Deutsche als Topos: Man hat den Deutschen ihre Musik gutgeschrieben, ihre Philosophie und irgendwann in den siebziger Jahren sogar ihren Film; nun wäre die bildende Kunst an der Reihe oder, besser gesagt, „die Kunst“ im Singular, die ihrerseits Produkt der Deutschen ist, und noch dazu der Romantik, der nationalen Epoche schlechthin.
Die NS-Vergangenheit: Die Deutschen werden diese Schlagseite nicht los, die sie selbst in die Weltgeschichte getragen haben. Harry Mulisch, der holländische Schriftsteller, hat mit „Die Zukunft von gestern“ ein Buch über einen nicht geschriebenen Nazi-Roman verfasst. Er erzählt darin unter anderem von seinem Besuch der Wagner-Festspiele in Bayreuth im Jahr 1971. Mulisch und seine Clique waren etwas derangiert dahergekommen, und sie wurden nun von den übrigen Besuchern taxiert. Was heißt taxiert, sie wurden, wie Mulisch die Klimax offenbar für opportun hält, „hochmütig gemustert und mit Blicken getötet, niedergeschossen, aufgehängt, vergast, weil wir unsere Krawatten abgenommen haben“. Jeder kennt als Deutscher derlei Aufzählungen, die Aufrechnungen sind und in denen der Aufrechnende sich selbst für ebenso verwegen hält wie die Aufgerechneten für die Bösen.
Die Großstadt Berlin: Deutschland hat wieder eine Kapitale, die den Namen verdient, und es ist sicher kein Zufall, dass die Konjunktur des Deutschen in der globalisierten Kunst mit dem (Wieder-)Aufstieg Berlins und seiner erneuerten Sogwirkung zusammenfällt. Berlin hat in den Zwanzigern gesehen, wie prekär Glanzzeiten sind, seine Kultur hat das Wissen um die Gefährdetheit stets wachgehalten, und das traurigste Ende, das jemals eingetreten ist, hat es gleich mitgeliefert. Das latent Katastrophische auch der Gegenwart ist in Berlin ganz bei sich.
Das Institutionelle: Vielleicht hat Deutschland bzw. die deutschprachige Hemisphäre mehr Opernhäuser als der Rest der Welt zusammen. Doch der deutsche Föderalismus, die vielgescholtene, jeder Metropole widerspenstige Kleinstaaterei, hat auch in der Bildenden Kunst vieles parat: Die Parallelität städtischer und staatlicher Häuser in vielen Orten zum Beispiel, das Lenbachhaus und die Pinakotheken in München, die Kunsthalle und K 20 bzw. K 21 in Düsseldorf, das Kunstmuseum und die Staatsgalerie in Stuttgart; oder die alten Kunstvereine und die Neugründungen aus dem Geist der 68er Revolte wie in Hannover; überhaupt das Prinzip Sezessionismus mit seiner Politik der Abspaltung, die immer neue Institutionen zu den selbstverständlich weiter existierenden alten fügt; schließlich insgesamt die Konkurrenz der Kommunen und Länder um Akademien, Szenen, Einflussbereiche, um Messen und Märkte.
Das Deutsche in der Kunst ist längst ein Kalkül; eine Koketterie mit der Interessantheit; die Engführung dessen, was es alles gibt, auf eine bestimmte Situation hin; die Aufladung des Alltäglichen mit dem Prekären; ein Kurzschließen des selbstverständlich Internationalen mit dem willkürlich Nationalen. Niemand ist angehalten heutzutage, das Deutsche zum Thema zu machen, doch wenn man es auffaltet, dieses ambivalente Ambiente, dann hat man zumindest mit einem Fluidum zu rechnen: mit der Ungebrochenheit der Gebrochenheit.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger 

 Teilen
Teilen