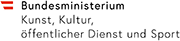Rainer Metzger,
Öffentliche Guerilla
Alle, denen derlei gefällt oder auch nicht, dürfen momentan wieder am Public Viewing teilnehmen. Der Versuch, sich in großer Menge auf kleine Farbpunkte in weiterer Entfernung zu fokussieren und dabei eine Art Euphorie zu entwickeln, ist ein grandioser Beweis dafür, dass sich der Städte neue Formen der Kollektivität bemächtigen. Gerade berichtet das artmagazine von einer Austellung, in der zwei Berliner Street Artisten dokumentieren, wie sie derlei Bemächtigungen unter der Ägide der Kunst veranstalten (Susanne Rohringer, Wider die Norm). Das Label „Kunst“ ist notorisch darin, das Illegale unter Aspekte des Legitimen zu platzieren. Im Wortsinn unkonventionell ist an solchen Interventionen schon lange nichts mehr. Wie Public Viewing zeigt, vollziehen sich die erfolgreicheren Versionen der neuen Besetzung urbaner Situationen in deutlich außerästhetischer Sphäre.
Eine Art Gegenveranstaltung zum vom Sport befeuerten Rausch öffentlichen Hinsehens liefern wiederum die Diners en blanc. Hier versucht man sich in alteingesessenen Formen der Manierlichkeit, kleidet sich in unschuldiges Weiß, sitzt an Tischen mit Kerzen und nimmt teil am standardisierten Ritual zur Darbietung gepflegten Verhaltens, dem Essen. Den Fond liefern dabei gern Orte, an denen die Hochkultur ganz bei sich ist, in München tafelt man vor der Oper, in Paris am Louvre, Abendessen wird kurzgeschlossen mit Abendland, und immerhin darf, kommuniziert durch die obligatorischen Social Media, jeder so tun, als ginge es ihm um die Reformierung einer Öffentlichkeit der Gleichgesinnten und -gesitteten.
Wie beim Internet, ohne das derlei Events sowieso nicht funktionierten, auch, steht indes die Frage im Raum, wieweit dieses Private, das nicht allein dadurch öffentlich wird, dass es viele sind, die sich hier in ihre Abgründe blicken lassen, gehen kann. Dem Zug ins Versponnen-Heimelig-Spießige, ins Prenzlauer Berg- und neuerdings Glockenbachviertel-Hafte versucht man durch martialische Begrifflichkeit zu entkommen. Kaum eine der Aktionen, die nicht so tut, als wären ihre Teilnehmer allesamt Tupamaros. Also gibt es Guerilla Knitting und Guerilla Gardening, es gibt Guerilla Crosswalks und Guerilla Bakery, und für alle, denen die Infantilisierung nicht weit genug geht, hängt eine Schaukel vom Baum, an der man dann Guerilla Swinging betreibt. Chair Bombing nennt man das Wohnzimmermobiliar auf der Straße, Weed Bombing ist das in anarchischer Geste verstreute Unkraut, Space Hijacking betreibt man in der U-Bahn, und die Drucksorten und sonstigen Arten der Distribution sind als Graphic Warfare zu haben. In dieser Terminologie der Wichtigtuerei zeigen die Aktivitäten immerhin, dass sie von der Kunst gelernt haben.
 In „Wir sind die Stadt! Urbanes Leben in der Digitalmoderne“ hat Hanno Rauterberg für den Augenblick des letzten Jahres zusammen gefasst, was sich an outgesourctem Innenleben dingfest machen ließ. Dass all diesen Engagements ein Hang zur „Verdörflichung“ innewohnt, ist schwerlich zu übersehen, Rauterberg sieht auch die „Gefahr des reinen Particitainment“, einer „Bürgerbeteiligung, die nur mehr eine Schau- und Showveranstalung ist“. Und er zitiert, gleichsam als Goodwill-Aktion, Stendhal: „Urbanität ist die überlegene Unfähigkeit, sich über schlechte Manieren anderer zu ärgern.“ So gesehen ist unsereiner zur Urbanität dann leider nicht imstande.
In „Wir sind die Stadt! Urbanes Leben in der Digitalmoderne“ hat Hanno Rauterberg für den Augenblick des letzten Jahres zusammen gefasst, was sich an outgesourctem Innenleben dingfest machen ließ. Dass all diesen Engagements ein Hang zur „Verdörflichung“ innewohnt, ist schwerlich zu übersehen, Rauterberg sieht auch die „Gefahr des reinen Particitainment“, einer „Bürgerbeteiligung, die nur mehr eine Schau- und Showveranstalung ist“. Und er zitiert, gleichsam als Goodwill-Aktion, Stendhal: „Urbanität ist die überlegene Unfähigkeit, sich über schlechte Manieren anderer zu ärgern.“ So gesehen ist unsereiner zur Urbanität dann leider nicht imstande.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger
 In „Wir sind die Stadt! Urbanes Leben in der Digitalmoderne“ hat Hanno Rauterberg für den Augenblick des letzten Jahres zusammen gefasst, was sich an outgesourctem Innenleben dingfest machen ließ. Dass all diesen Engagements ein Hang zur „Verdörflichung“ innewohnt, ist schwerlich zu übersehen, Rauterberg sieht auch die „Gefahr des reinen Particitainment“, einer „Bürgerbeteiligung, die nur mehr eine Schau- und Showveranstalung ist“. Und er zitiert, gleichsam als Goodwill-Aktion, Stendhal: „Urbanität ist die überlegene Unfähigkeit, sich über schlechte Manieren anderer zu ärgern.“ So gesehen ist unsereiner zur Urbanität dann leider nicht imstande.
In „Wir sind die Stadt! Urbanes Leben in der Digitalmoderne“ hat Hanno Rauterberg für den Augenblick des letzten Jahres zusammen gefasst, was sich an outgesourctem Innenleben dingfest machen ließ. Dass all diesen Engagements ein Hang zur „Verdörflichung“ innewohnt, ist schwerlich zu übersehen, Rauterberg sieht auch die „Gefahr des reinen Particitainment“, einer „Bürgerbeteiligung, die nur mehr eine Schau- und Showveranstalung ist“. Und er zitiert, gleichsam als Goodwill-Aktion, Stendhal: „Urbanität ist die überlegene Unfähigkeit, sich über schlechte Manieren anderer zu ärgern.“ So gesehen ist unsereiner zur Urbanität dann leider nicht imstande.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger 

 Teilen
Teilen