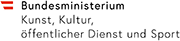Song Contest
„Wir sind Wurst“: So stand es im „Standard“ zu lesen, als die kleinstaatliche Identität Österreichs nach langem Darben wieder einmal dorthin kam, wo sie sich immer schon zugehörig wähnte: ganz zu sich. Soviel Selbstironie bringt man nur in Momenten des Triumphs auf, und er war in der Tat überwältigend: Mit 290 aus ganz Europa eingesammelten Punkten erreichte Österreichs Vertreterperson beim Eurovision Song Contest das immerhin viertbeste Ergebnis, wie sagt man an dieser Stelle, aller Zeiten. Fast 15.000 Postings haben sich beim Live Chat des „Standard“ ergeben, ebenfalls ein Ergebnis für alle Zeiten. Als Udo Jürgens das letzte Mal für sein Heimatland den Titel eroberte, 1966, war der Hype noch etwas kleiner.
Der Song Contest, früher soigniert Grand Prix d'Eurovision de la Chanson genannt, hat ja in der Zwischenzeit so etwas wie Kultstatus. Früher hatte es ABBA gegeben, denen er zur Weltkarriere verhalf, aber darüber hinaus in Produktion und Rezeption vor allem eingeschlafene Füße. Eine erste Euphorie von veritablen Fans war 1992 in Malmö zu bemerken, als sich Afficionados Zugang verschafften, indem sie sich als Offizielle ausgaben, als jene Funktionäre der Sender und angeschlossener Zeitungen, die bis dahin so etwas wie das Publikum waren. Als die BBC die Veranstaltung 1998 via Birmingham in die Welt sandte, machte man daraus Methode und vergab die Karten dezidiert an Anhänger. Dass der Sieger damals Dana international hieß, für Israel sang, transsexuell war und bei aller Begeisterung für die nationale Sache die speziell religiösen Kreise gehörig durcheinander brachte, konnte man dann nur als konsequent verbuchen.
Der Song Contest hatte seine Rolle gefunden. Länger schon hatten hier die Homosexuellen ihr Steckenpferd, jetzt wurde er was man früher Camp genannt hat und was heute ein Spielfeld der Hipster ist. Wie stets bei derlei transgressiven Akten eines zweifelhaften Geschmacks wurde der schräge Singsang irgendwann herausgeholt aus dem tragenden Milieu und zum Mainstream: einem Mainstream der Minderheiten, und zu denen gehören bekanntlich heutzutage alle.
Conchita Wurst hat mit perfekter Hybridisierung der Schrillheit einer Drag Queen und der Schüchternheit einer Jungfrau, der Betonung selbstbewusster Feminität und dem neu-alten Männlichkeitssignal eines in bester Pflege gehaltenen Vollbartes die gegenwärtige Identität Westeuropas affiziert: Es ging um die Demonstration von Liberalität, darum, sich per Voting als jemand zu bejubeln, für den alle nach ihrer Fasson glücklich werden dürfen. Der Zustand Osteuropas hat kräftig mitgeholfen: Die Autokratien aus der Konkursmasse der weiland Sowjetunion sind mittlerweile zu wenige und aktuell zu diskreditiert, als dass sie mehr vermochten, als sich in aller Geringfügigkeit ihre Punkte zuzuschanzen. Dass alte Seilschaften nicht zustande gekommen waren – Kroatien und Serbien fehlten für Montenegro, Zypern für Griechenland - tat das Übrige.

Conchita Wurst nach der Übergabe der Trophäe auf der Bühne des Eurovision Song Contest. Foto: facebook
Natürlich bedeutet die Demonstration von Liberalität nicht Liberalität selber. So kommt der Sieger immerhin aus einem Land, in dem ein Viertel der Wähler sich für eine rechtsradikale Partei entscheidet. Aber wie schreibt Diedrich Diederichsen in seinem Opus Magnum „Über Pop-Musik“, mit dem wir uns noch eingehender beschäftigen werden: Die „eigentliche Aufgabe der Pop-Musik“ sei die „Verbesserung der Versprechungen“. In diesem Sinn ist die Aussicht auf eine freiere Gesellschaft durch Conchita Wurst mit bisher ungeahnter Kompetenz skizziert worden. Kaum auszudenken, dass das Land, Österreich, jetzt nachzieht.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger 

 Teilen
Teilen