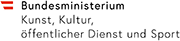Rainer Metzger,
Abendstern von hinten
Wenn eines Tages eine Fee kommt und verspricht, uns die drei Lieblingsbilder zu holen, dann müsste sie mit allerhand nacktem Fleisch zurückkehren: Giorgiones Dresdner Venus hätte sie im Gepäck, die Venus mit dem Spiegel von Velazquez und Manets Olympia. Dieser Dreierpack, so hören wir schon den Einwand, ist typisch: Da hat einer seine Porno-Bedürfnisse mit dem Prestige vermengt, das aus dem Museum kommt. Wenn es nur so einfach wäre! Sind es nur die Rundungen, die einem attraktiver erscheinen als die Knollennasen Rembrandts? Sind es nur die Hingabeposen, die einem appellativer vorkommen als die Standbein-Spielbein-Variationen Raffaels? Was ist es?
Nein, es gelingt auch Andreas Prater nicht, den speziellen Glanz zu benennen, in dem die Abendsterne bildmächtig schimmern. Seine Monografie hat sich ganz der Schönheit verschrieben, die in Diego Velazquez
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger
Gemälde vor allem hinterrücks zur Kenntlichkeit kommt. Die nach einem ihrer Vorbesitzer Rokeby-Venus genannte Repoussoir-Rarität, der ein kleiner Amor den Spiegel hinhält, ist eines der ganz seltenen Beispiele für einen Akt in Spaniens Malerei. Damit ist das Terrain abgesteckt, um der Kunstgeschichte als akademischer Disziplin Raum zu geben für die Ausbreitung ihres ganzen Wissens. Und Prater weiß. Von sattsam Erwartbarem, etwa dem Einfluss des Neoplatonismus, bis zu unsittsam Neuem, zum Beispiel, dass es den Damen seinerzeit geraten schien, sich auf die rechte Körperseite zu betten, wenn die Empfängnis funktionieren sollte, klärt der Freiburger Professor auf, was sich an Alltäglichem und Allegorischem um VelazquezLiegenschaft rankt. Das Werk, so wird es auf den Punkt gebracht, gehöre in die Tradition der Epithalamien, es ist ein Hochzeitsbild, angefüllt mit allen guten Wünschen für zahlreiches Gedeihen. Raffinesse eingeschlossen, denn das Reflexionsspiel mit dem Spiegel nimmt den Ehemann mit auf ins Brautbett. Virtuell reimt sich auf viril. Was aber ist es, das uns Heutige vor diesem neckisch drapierten Adamskostüm stehen bleiben lässt, länger womöglich als vor anderen Hauptstücken der Londoner National Gallery? Ist es Aura, wie Walter Benjamin meint? Ist es, wie Roland Barthes es nennt, Jouissance, der erotisierte Diskurs? Ist es die Frage aller Fragen: Trägt diese Venus Schamhaar? Andreas Prater, Im Spiegel der Venus. Velazquez und die Kunst einen Akt zu malen, Prestel, München 2002
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger 

 Teilen
Teilen