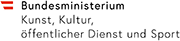Rainer Metzger,
Duell in Dachau
Wahlkampf ist. Gerade war sogar, ich rede jetzt von Deutschland, in Österreich findet so etwas dreimal am Tag statt, TV-Duell. Frau Merkel erwartungsgemäß staatstragend mit schwarz-rot-goldener Halskette, Herr Steinbrück in alle Koalitionsmöglichkeiten ventilierender blauer Krawatte mit hoffnunggebenden Streifen von links unten nach rechts oben. Wahlkampf ist, und es schlafen einem die Füße ein. Rede ich also vom einzigen Ereignis, das mir diesbezüglich bemerkenswert scheint, allerdings weniger, was politische Positionen angeht.
Dieses Ereignis ist der Besuch der Bundeskanzlerin in der KZ-Gedenkstätte Dachau vor vierzehn Tagen. Die Reportagen, die davon berichteten, handelten davon, dass Angela Merkel die erste Trägerin dieses Amtes war, die sich einer solchen Verpflichtung unterzogen hat; und sie handelten davon, dass es genau sieben Minuten dauerte, bis der nächste Termin absolviert wurde, und der fand im jovial-bajuwarischen Dunstkreis eines Bierzeltes statt, mit Blasmusik und guter Laune.
Natürlich ist Wahlkampf. Man könnte es, und das scheint mir plausibler, auch erinnerungspolitisch fassen: Das Gedenken an die NS-Zeit, an ihre Verbrechen und die Verstrickung der Deutschen ist längst ritualisiert. Die Schuld ist benannt, die Verantwortung für ein Nie-Wieder unermüdlich auf sich genommen, und anschließend stoßen wir an auf die Normalität. Wie Jochen Gerz, der einzige der bildenden Künstler deutscher Herkunft, der einst in der Lage war, adäquate Denkmäler zu erstellen, gesagt hat: Wenn du eine Gedenkstätte zur NS-Vergangenheit bauen kannst , brauchst du sie nicht mehr bauen.
Die Nazi-Zeit ist PR-tauglich geworden. Der Erfolg von „Er ist wieder da“, dem literarischen Erstling des Boulevard-Journalisten Timur Vernes, spricht dafür in siebenstelliger Auflage verbreitete Bände, die Geschichte eines Adolf Hitler, der wieder auftaucht und im Berliner Milieu der Zyniker und Ich-AGler den Simplizissimus abgibt; Vernes macht, was Werbefritzen machen: Er verkauft sein Objekt als Sympathieträger. Man kann den größten Feldherr aller Zeiten auch ins Groteske schieben, wie es 2007 Dani Levy mit Helge Schneider in der Titelrolle im Film „Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler“ vorführte.
 Screenshot aus Florian Wittmanns Abschlussarbeit
Oder man zeigt seine medientechnische Gewandtheit und fabriziert eine Abschlussarbeit an einer Kunsthochschule, indem man Ausschnitte von Leni Riefenstahls 1934er Reichsparteitagsfilm mit einem Hörstück koppelt, in dem Gerhard Polt sein Mütchen am berühmten „Leasingvertrag“ kühlt: Florian Wittmanns in der Tat geschickte, Bild und Text in der gemeinsamen Rhetorik der Beschwerde, des Ressentiments und des Selbstmitleids und vor allem in der Thematik des Vertrags – einmal des Versailler, dann des Leasingvertrags – in Parallele stellende Montage war ein Youtube-Renner im Jahr 2006. (Wittmanns Video-Arbeit unter http://www.youtube.com/watch?v=15I91i8RnnE)
Anything Goes jedenfalls auch mit den ominösesten zwölf Jahren der Weltgeschichte. Das letzte Tabu, das der Kunstbetrieb zwischen unaufgeräumten Jugendzimmern und Pornos aus dem Internet immer noch beherzigte, ist mittlerweile gebrochen: Die Nazi-Ware ist appropriiert, nachdem Dinos und Jake Chapman vor einiger Zeit Hand an Aquarelle gelegt haben, in denen sich der nachmalige Führer einst als Kunstmaler versuchte. Die Gedächtniskultur, so sieht es aus, ist an ihrer unbändigen Arbeit zugrunde gegangen. Der Teufel der NS-Zeit ist ausgetrieben, nun fristet er sein Dasein als Jahrmarktsfigur. Frau Merkel darf ihn zum Schießen finden.
Screenshot aus Florian Wittmanns Abschlussarbeit
Oder man zeigt seine medientechnische Gewandtheit und fabriziert eine Abschlussarbeit an einer Kunsthochschule, indem man Ausschnitte von Leni Riefenstahls 1934er Reichsparteitagsfilm mit einem Hörstück koppelt, in dem Gerhard Polt sein Mütchen am berühmten „Leasingvertrag“ kühlt: Florian Wittmanns in der Tat geschickte, Bild und Text in der gemeinsamen Rhetorik der Beschwerde, des Ressentiments und des Selbstmitleids und vor allem in der Thematik des Vertrags – einmal des Versailler, dann des Leasingvertrags – in Parallele stellende Montage war ein Youtube-Renner im Jahr 2006. (Wittmanns Video-Arbeit unter http://www.youtube.com/watch?v=15I91i8RnnE)
Anything Goes jedenfalls auch mit den ominösesten zwölf Jahren der Weltgeschichte. Das letzte Tabu, das der Kunstbetrieb zwischen unaufgeräumten Jugendzimmern und Pornos aus dem Internet immer noch beherzigte, ist mittlerweile gebrochen: Die Nazi-Ware ist appropriiert, nachdem Dinos und Jake Chapman vor einiger Zeit Hand an Aquarelle gelegt haben, in denen sich der nachmalige Führer einst als Kunstmaler versuchte. Die Gedächtniskultur, so sieht es aus, ist an ihrer unbändigen Arbeit zugrunde gegangen. Der Teufel der NS-Zeit ist ausgetrieben, nun fristet er sein Dasein als Jahrmarktsfigur. Frau Merkel darf ihn zum Schießen finden.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger
 Screenshot aus Florian Wittmanns Abschlussarbeit
Oder man zeigt seine medientechnische Gewandtheit und fabriziert eine Abschlussarbeit an einer Kunsthochschule, indem man Ausschnitte von Leni Riefenstahls 1934er Reichsparteitagsfilm mit einem Hörstück koppelt, in dem Gerhard Polt sein Mütchen am berühmten „Leasingvertrag“ kühlt: Florian Wittmanns in der Tat geschickte, Bild und Text in der gemeinsamen Rhetorik der Beschwerde, des Ressentiments und des Selbstmitleids und vor allem in der Thematik des Vertrags – einmal des Versailler, dann des Leasingvertrags – in Parallele stellende Montage war ein Youtube-Renner im Jahr 2006. (Wittmanns Video-Arbeit unter http://www.youtube.com/watch?v=15I91i8RnnE)
Anything Goes jedenfalls auch mit den ominösesten zwölf Jahren der Weltgeschichte. Das letzte Tabu, das der Kunstbetrieb zwischen unaufgeräumten Jugendzimmern und Pornos aus dem Internet immer noch beherzigte, ist mittlerweile gebrochen: Die Nazi-Ware ist appropriiert, nachdem Dinos und Jake Chapman vor einiger Zeit Hand an Aquarelle gelegt haben, in denen sich der nachmalige Führer einst als Kunstmaler versuchte. Die Gedächtniskultur, so sieht es aus, ist an ihrer unbändigen Arbeit zugrunde gegangen. Der Teufel der NS-Zeit ist ausgetrieben, nun fristet er sein Dasein als Jahrmarktsfigur. Frau Merkel darf ihn zum Schießen finden.
Screenshot aus Florian Wittmanns Abschlussarbeit
Oder man zeigt seine medientechnische Gewandtheit und fabriziert eine Abschlussarbeit an einer Kunsthochschule, indem man Ausschnitte von Leni Riefenstahls 1934er Reichsparteitagsfilm mit einem Hörstück koppelt, in dem Gerhard Polt sein Mütchen am berühmten „Leasingvertrag“ kühlt: Florian Wittmanns in der Tat geschickte, Bild und Text in der gemeinsamen Rhetorik der Beschwerde, des Ressentiments und des Selbstmitleids und vor allem in der Thematik des Vertrags – einmal des Versailler, dann des Leasingvertrags – in Parallele stellende Montage war ein Youtube-Renner im Jahr 2006. (Wittmanns Video-Arbeit unter http://www.youtube.com/watch?v=15I91i8RnnE)
Anything Goes jedenfalls auch mit den ominösesten zwölf Jahren der Weltgeschichte. Das letzte Tabu, das der Kunstbetrieb zwischen unaufgeräumten Jugendzimmern und Pornos aus dem Internet immer noch beherzigte, ist mittlerweile gebrochen: Die Nazi-Ware ist appropriiert, nachdem Dinos und Jake Chapman vor einiger Zeit Hand an Aquarelle gelegt haben, in denen sich der nachmalige Führer einst als Kunstmaler versuchte. Die Gedächtniskultur, so sieht es aus, ist an ihrer unbändigen Arbeit zugrunde gegangen. Der Teufel der NS-Zeit ist ausgetrieben, nun fristet er sein Dasein als Jahrmarktsfigur. Frau Merkel darf ihn zum Schießen finden.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger 

 Teilen
Teilen