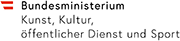Rainer Metzger,
John Moores Prize
Schöne Grüße aus Liverpool. Da bin ich gerade, denn, wie ein kluger Mensch einmal gesagt hat, Ferien kann man sowieso nur in England machen. Liverpool hat sich enorm aufgeschickt, es gibt am Mersey-Ufer eine Art Zweitversion der Londoner Docklands, was so gelungen wie unangenehm ist, weil es das übliche Getue mit internationalem Boutiquen-Jet-Set zelebriert (inklusive einer Tate Liverpool, die sich als Sparversion geriert, weil das Areal doch nicht ist, was es in London verspricht). Darüberhinaus hat die Stadt beschlossen, sich als das Salzburg der Beatles aufzuführen, und auch wenn die Fab Four noch etwas weniger lang vor ihrem Ort waren wie das Wolferl vor seinem, versuchen sie jetzt daraus eine angestammte Identität zu zimmern. Das Ergebnis ist in etwa gerade so peinlich wie in Salzburg. Ihre Festspiele haben sie auch: Das Mathew Street Festival, immer Ende August, wo jeder, der fehlerfrei „Love Me Do“ aufsagen kann, eine Chance hat. Mathew Street ist die Getreidegasse Liverpools, da liegt der Cavern Club, wo die Fab Four sich ihre Sporen verdienten, 300 Auftritte zwischen 1960 und 1963. Natürlich war der Cavern dazwischen längst eine Ruine, und natürlich hat man ihn reaktiviert.
Das Kleinod der Stadt, künstlerisch gesehen, ist die Walker Art Gallery. Die führt ihr Dornröschendasein, denn unter all den Gentrification-Herrlichkeiten ist sie zu wenig sexy. Dabei ist sie großartig, eine verlorene Schönheit, ein Museum der Museologie, mit Hängungen in zwei, drei Reihen, perfektem Viktorianismus und entsprechenden Werken. Highlights: William Hogarths Porträt des ersten modernen Schauspielers, David Garrick, der exaltiert gezeigt ist, wie er Shakespeares Richard III deklamiert; das Selbstbildnis von Anton Raphael Mengs; vielerlei Präraffaelitisches; ein wunderbares Nahbild dreier Kenner, die sich an einer antiken Kleinplastik delektieren, von Joseph Wright of Derby; „Dante trifft Beatrice“, spätes 19. Jahrhundert, von einem Meister namens Henry Holiday, dessen Name und Manier einem Schlagersänger zu Gesicht stünden.
Behind the scenes - stage 2 judging of John Moores 2010 from National Museums Liverpool on Vimeo
Dann eine Spezialausstellung. Ein Rückblick auf den John Moores Prize, den kein Mensch kennt, der aber nicht weniger ist als der Vorläufer des vielgerühmten Turner Preises. Ein typisch englischer Unternehmer und Philanthrop ließ es sich angedeihen, das Volk der zeitgenössischen Kunst zu öffnen, einen Preis auszurufen und ihn mit stattlichem Geldbetrag auszustatten: Heute sind es 25.000 Pfund. Es gibt diesen Preis seit 1957, biennal wird er vergeben, jeder kann mitmachen, mit einem Werk vorstellig werden, wie in alten Zeiten des Salons. 1967 hat David Hockney den Preis bekommen, mit seinem Schlüsselwerk und der Inkunbabel einer souverän schwulen Kunst „Peter getting out of Nick’s Pool“. 1993 traf es Peter Doig, der damals ein Nobody war, ein Jahr bevor er beim Turner Preis immerhin auf die Short List kam. Die Jury des John Moores Prize besteht aus Kuratoren, Künstlern, Kennern, 1965 gab sich kein geringerer als Clement Greenberg die Ehre. In diesem Herbst wird die 26. Auflage gegeben.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger 

 Teilen
Teilen