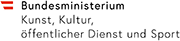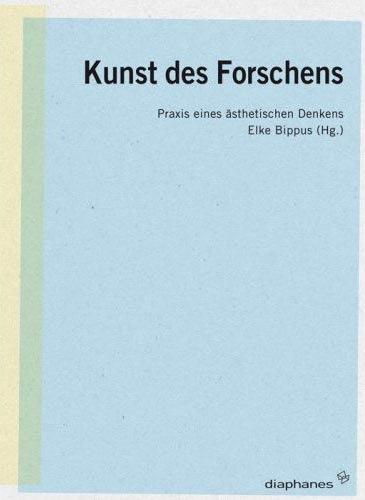
Jens Kastner,
Die Erkenntnispraxis der Kunst
Auch im Kunstfeld gibt es thematische Konjunkturen. Ein konjunkturelles Hoch – ablesbar an Themenausstellungen, Stellenbeschreibungen, Symposien und Publikationen – erlebt seit einiger Zeit das Forschen, der Zusammenhang von ästhetischer und wissenschaftlicher Praxis. Die Rolle der Kunst in der „Wissensgesellschaft“ oder, davon relativ unabhängig, das Wissen, welches die Kunst schon immer hervorgebracht habe, stehen damit u.a. zur Debatte.
Einen Einblick in diese Diskussionen gibt nun der von Elke Bippus herausgegebene Band. Künstlerisches Forschen wird darin nicht nur als besondere Form der Wissensproduktion skizziert, beschrieben und bebildert. Diese Besonderheit ist nicht allein eine deskriptive Differenz zu wissenschaftlichem und philosophischem Wissen, sondern sie erfährt auch eine klare Wertung: Künstlerisches Forschen schaffe „Räume für das Denken“ und stehe daher „zumeist in Widerspruch [...] zu einer neuerdings angesagten Verwertbarkeit.“ (Bippus)
Während Dieter Mersch theoretisch anspruchsvoll die Unterschiede zwischen wissenschaftlicher und künstlerischer Wissensproduktion herausarbeitet, ist laut Chrsitoph Schenker die Pragmatik der Forschung in beiden Bereichen „nicht wesentlich verschieden.“ Sammelbände können auch durch solch disparate Statements spannend werden. Merschs Quintessenz, die Kunst als „Erkenntnispraxis eigenen Rechts“ zu behaupten, widerspricht allerdings auch Schenker schließlich nicht: Künstlerische Forschung meint bei ihm, geradezu altavantgardistisch, die „Intensivierung des Lebens.“ Versöhnlich spricht Beatrice von Bismarck am konkreten Beispiel der „Installation“ von Julie Ault und Martin Beck in der Wiener Secession von einem „eigenständigen und zugleich wechselseitig produktiven Verhältnis zu anderen Formen der Forschung.“ Diese verschiedenen Vermittlungen unterschiedlicher Wissensformen ebenso transparent zu machen wie auszubuchstabieren, ist ein Verdienst des Bandes.
Peter Pillers Fotoserie „Vorzüge der Absichtslosigkeit“ kontrastiert hingegen qua Titel wieder eher mit der reflexiven und repräsentationskritischen Ausrichtung, die Bippus der künstlerischen Forschung insgesamt zuweist. Diesen Fokus teilt sie mit den postoperaistischen, feld- und hegemonietheoretischen Strömungen der Kunst-Macht-Wissen-Debatte, die im an der Ereignishaftigkeit der Kunst orientierten Buch deutlich unterrepräsentiert sind. In Jörg Hubers Beitrag heißt ein solcher gemeinsamer Nenner künstlerischer Forschung – und des forschenden Blicks auf sie – eine „(ästhetische) Praxis der Kritik“.
Elke Bippus (Hg.): Kunst des Forschens. Praxis eines ästhetischen Denkens, Zürich/berlin 2009, Diaphanes Verlag.
 Mehr Texte von Jens Kastner
Mehr Texte von Jens Kastner
 Mehr Texte von Jens Kastner
Mehr Texte von Jens Kastner 

 Teilen
Teilen