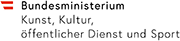Rainer Metzger,
Vienna
Vor hundert Jahren standen in der Welt Dutzende von Riesenrädern. Heute gibt es, jene vorübergehenden Erscheinungen auf Jahrmärkten und Sekundärattraktionen in Freizeitparks beiseite gelassen, nur noch eines, das Wiener. Das mag man für Zufall halten, doch wenn man bedenkt, dass das unablässige Rotieren in der Vertikalen ein ebenfalls in Wien beheimatetes Pendant in der Horizontalen hat, das nicht minder stetige Umkreisen einer Mitte auf der Ringstraße, dann ließe sich auch so etwas wie Logik erkennen. In Paris gibt es den aufstrebenden Fingerzeig des Eiffelturms und es gibt, als Umsetzung in die Ebene, die raumdurchmessende Linearität der Boulevards. Kulturen leben, ob sie wollen oder nicht, von Sinnbildern.
Der Mechanismus des Riesenrades ist die Bewegung um ein Zentrum. Er ist, abstrakter formuliert, eine Geste, die ein Innen in sich schließt, und genau dies markiert das österreichische Idiom schlechthin. Unabdingbar gehört ein Vexiereffekt dazu, der im Unklaren läßt, was die Raison des Abzirkelns ist: Das Innen oder die Geste. Ist es die Nabe oder die Drehung? Ist es, urbanistisch gesehen, Wiens erster Bezirk oder seine imperiale Umzäunung? Ist es, analytisch gesehen, die Psyche oder ihr Analytiker? Ist es, ästhetisch gesehen, das Interieur oder die Dekoration? Und ist es, gastronomisch gesehen, das Schnitzel oder die Panier?
Ist es der Bub oder seine Mama? Das Mädchen oder der Papa? Ist es also das Ego oder die Sippschaft, in die es notgedrungen hineingehört, mit all ihren Sonderheiten und Absonderlichkeiten? Gerade ist mit dem obligatorischen Tamtam einer Erstauflage von 50.000 Stück ein Roman erschienen, der sich dieser speziellen Facette der österreichischen Identität widmet, die weniger mit Jammern als mit Ironie auf den Status Quo reagiert. Eine solche Ironie sucht die Mitte in ihrem Umkreisen und weiß um eine Psyche, die erst im Analysieren entsteht.
Eva Menasses "Vienna" ist in der Zwischenzeit ziemlich verrissen worden. Speziell in Österreich ist es verrissen worden. Und tatsächlich: Weil das Buch um die Korrespondenz von Ego und Alter weiß, sucht es keine Schuld, schon überhaupt nicht bei den anderen. Eine solche Haltung war nicht sehr literaturtauglich in den letzten Jahrzehnten. Hierzulande.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger 

 Teilen
Teilen