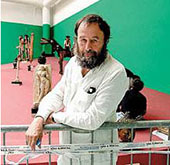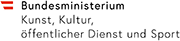Harald Szeemann 1933 - 2005
Das Ein-Mann-Theater
Als er am 11. Juni 2003 seinen 70. Geburtstag feierte, saß er im Flugzeug. Die Mutter aller Biennalen, die venezianische, hatte gerufen, und Harald Szeemann wollte nachsehen, wie es ihr jetzt geht. "Ich bin der Grossvater aller unabhängigen Kuratoren", sagte der Altmeister, als wir uns kurz vorher anlässlich seiner Balkan-Schau, die er für die Sammlung Essl eingerichtet hatte, trafen. Es galt, die Sippschaft zusammenzuhalten.
Bevor er in den Kunstbetrieb wechselte, hatte er ein Ein-Mann-Theater auf die Bühne gestellt, und er betrieb es bis zu seinem Lebensende am vergangenen Freitag. Seine "Agentur für geistige Gastarbeit", 1969 gegründet, war einhergegangen mit seinem Ausscheiden aus der Kunsthalle Bern, der er mit der Dekaden-Revue "When Attitudes Become Form" eine Jahrhundertschau verschafft hatte. Zwanzig Jahre lang, von 1981 bis 2001, hat Szeemann dann mit dem Kunsthaus Zürich zusammengearbeitet, allerdings, und auf diese Feststellung legte er Wert, ohne "Mitglied des Staff zu sein und ohne Pensionsberechtigung". Eben als Freiberufler.
Dazwischen, davor und daneben hatte er Ausstellungen ins Werk gesetzt. Seine documenta fünf von 1972 erwies sich als die bedeutendste, denn sie hatte aufgeräumt mit den fixen Wahrheiten und das Prinzip permanenten Wandels in die Statik der Präsentationen gebracht. "Individuelle Mythologien" nannte man mit dem vielleicht erfolgreichsten Begriff, den Szeemann kreierte, die neuen Unwägbarkeiten. Parallel zum aufkommenden Wildwuchs entstand die Figur eben des Kurators, des seinerseits individuellen Mythologen, der die Schneisen schlug in die Unübersichtlichkeit.
"Von der Vision bis zum Nagel" lautete sein ganz dem Do-It-Yourself verschriebenes Motto. Seine Arbeits- und Wohnsituation in Tegna im Tessin, zusammen mit seiner Frau Ingeborg Lüscher in Betrieb gehalten, nannte er "Fabrik". Und weil er als Patriarch wusste, dass man nichts aus der Hand geben darf, arbeiteten sein Sohn und seine Tochter in der Zwischenzeit mit: "Die Tochter macht in der letzten Nacht dann meistens die Schildchen".
35 Jahre lang stand Szeemann da als Monument des Menschenmöglichen. Und er gab wie kein anderer dem Ausstellungen Machen eine Moral. Er war überzeugt, etwas bewegen zu können, etwas für die Künstler und etwas für die Häuser. "Die Dimension einer Welt, einer temporären Welt" sollte erstehen; dafür brauchte es Zeit, Überlegung und so etwas Altmodisches wie Hingabe: "Eine Ausstellung und dann in drei Wochen wieder eine, das geht nicht; das ist nicht seriös." Ob sich denn Großausstellungen von der Statur der documenta denn nicht sowieso überlebt hätten? Antwort: "Das Prinzip hat sich auf eine Art und Weise nicht überlebt, wie sich etwa Wallfahrtsorte nicht überlebt haben."
Ganz einfach Berge versetzen: Harald Szeemann war der Prophet im Weltdorf.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger 

 Teilen
Teilen