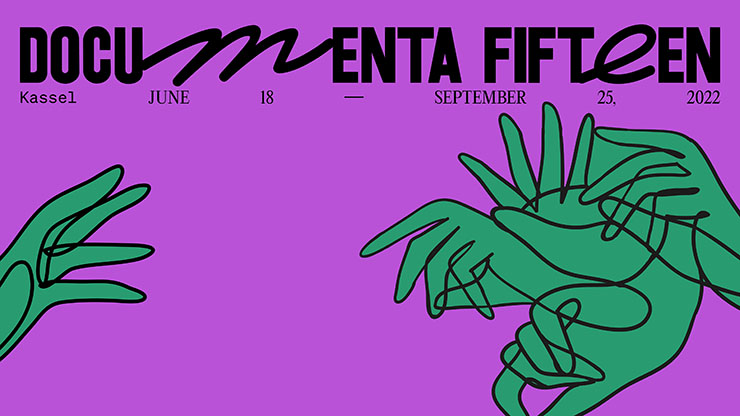
Noch einmal: documenta
Sozialismus, VIktimismus. Da muss man noch einen weiteren der Zauber-Ismen, Kolonialismus, nicht einmal hinzu memorieren, um sie bannerhaft, eingehakt in die Solidarität mit der „Dritten Welt“, vor sich her zu tragen. Da vermischt sich dann der Klassenkampf mit dem Rassenkampf, und wie sagte schon Martin Walser, als ihm sein Leib- und Magen-Kontrahent wieder einmal sauer aufstieß: „Jeder Autor, den er so behandelt, könnte zu ihm sagen: Herr Reich-Ranicki, in unserem Verhältnis bin ich der Jude.“
Antisemitismus also. Und das auf der documenta. Vieles ist dazu mittlerweile gesagt, doch eine Sorte der Vielsagenden hält sich die letzten Tage doch auffallend zurück: die sehr vorauseilend Wohlmeinenden, die vorab Beschämenden, die Ruangrupa mit Enthusiasmus Zudeckenden, für die alle, die das seltsame Gebaren des neuerdings so vornehm behandelten Artivismus mit einer gewissen Skepsis betrachten, Agenturen der Ausbeutung darstellen. In diesem Sinn stand bereits am 24. Mai im artmagazine von „völlig überzogenen Antisemitismusvorwürfen“ zu lesen, die das „altbildungsbürgerliche Feuilleton“ zu „verbalen und gedanklichen Entgleisungen“ brachte. Etc.
Gut, dass für das weltweit grassierende Altbildungsbürgertum der deutsche Bundespräsident ein paar Worte gesagt hat, Worte der Distanz zum gewissen Notorismus der documenta, als noch gar nicht feststand, wie nötig sie sein würden. Er hat sich dafür sogleich von monopol in Reihe bringen lassen dürfen: „Wichtiger (als die „Zurückweisung von Ausbeutung durch die westlichen Industrieländer“ – R.M) war ihm, die Gäste aus Indonesien zurechtzuweisen – ihnen zu sagen, wen genau man in Deutschland, im Land des Holocaust, einzuladen hat und wen nicht“. Zwei Tage später rudert die Chefredakteurin ein wenig zurück: Es „hätte das nicht passieren dürfen“ konstatiert sie gönnerinnenhaft; und: „Die Documenta schwächt ihre Position“. Womöglich hat da eine Feuilletonistin ihre Position gleich mitgeschwächt. Wenn es noch etwas zu schwächen gibt.
Ein weißer Mann, der in Berlin lebt, Jahrgang 1960, und eine weiße Frau, die in Berlin lebt, Jahrgang 1971, haben in einer Gegenwart, da ihnen die Paradigmenwechsel von allen Kontinenten des globalen Südens her nur so um die Ohren fliegen, ein gewisses Legitimationsproblem. Kimberle Cranshaws Schlüsselbegriff für die momentanen Sensibilitäten, Intersektionalität, wurde gegen die weißen mittelständischen Feministinnen geprägt, und das Prinzip weißer alter Mann, der in Berlin lebt, war wahrscheinlich noch nie sexy. So ist das heute. Wie wäre es mit akzeptieren? Das lässt sich mit Verbalinjurien nicht einholen. Es gibt ein schönes österreichisches Wort für das, was dieser Sorte Kolumnisterei jetzt winkt: schmähstad. Und das nicht nur für den Moment.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger 

 Teilen
Teilen

