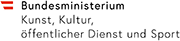Hexen: In der Hexenküche des Kapitalismus
Die panische Angst des Patriarchats vor der finsteren Macht weiblicher Sexualität ist berechtigt, man findet den auf die sarkastische Spitze getriebenen Beweis dafür in Video „Qu’un sang impur“, in dem eine Horde Frauen jenseits der Menopause erneut zu menstruieren beginnt und eine unbändige Gier nach männlichem Frischfleisch entwickelt. Auf junge Paketboten, Metzger, Jogger und andere Statisten wirkt sich das letal aus, die wild gewordenen Weiber landen dafür selbstredend im Knast, wo der Gefängniswärter sie fortan durchs Guckloch beim Ausleben ihrer Obsessionen beobachten und zugleich die eigenen pflegen kann.
Die französische Künstlerin Pauline Curnier Jardin nimmt hier Bezug auf Jean Genets Kurzfilm „Un chant d’amour“ aus 1950 sowie weibliche Rollenbilder und Reproduktionslogiken derartig pointiert aufs Korn, dass sich schon allein dafür der Besuch der aktuellen Schau im Innsbrucker Taxispalais lohnt. Thema ist ein perfides soziales Konstrukt namens „Hexen“, dessen ideologische und ökonomische Implikationen einen bis heute schaudern lassen.
Weibliche Sexualität galt bekanntlich bereits in der Logik der historischen Hexenverfolgung als Inbegriff des Bösen, nicht zufällig wurden vor allem auch Hebammen und Heilerinnen zu Opfern dieses grausamen Vernichtungsfeldzugs, standen sie doch auch für weibliches Wissen und die Kontrolle über den eigenen Körper. Und damit laut der italienischen Philosophin Silvia Federici für das Gegenteil dessen, was Frauen am Übergang von der feudalistischen zur kapitalistischen Gesellschaft als zentrale Aufgabe zugedacht war, nämlich: kuschen und ausbeutbare Arbeitskräfte gebären.
Die systematische Ausrottung der zu eben diesem Zweck erfundenen „Hexen“ hatte demnach mit dem „Widerstand der Frauen gegen die Ausbreitung kapitalistischer Verhältnisse“ zu tun: Diesen Gedanken spinnen Angela Anderson und Ana Hoffner ex-Prvulovic* in einer Raum- und Video-Installation weiter, die die Logiken kapitalistischer Ausbeutung bis in die Gegenwart herauf verfolgt. Es geht dabei auch um die beschämende Situation der Erntehelfer in Tirol.
Der Märchen- und Mythenecke wird hier also großräumig ausgewichen, es geht vielmehr um ganz reale gesellschaftliche Verwerfungen, verdrängte Wissenssysteme sowie alternative Formen der Wissens- und Werteproduktion. Bei Esther Strauß geht es auch um alternative Formen der Erinnerung: Gleich am Beginn des Ausstellungsparcours wird man mit einem lebensgroßen Selbstporträt der Künstlerin konfrontiert, es zeigt sie nackt und mit der Erde aus dem Grab des Großvaters beschmiert. Joachim Koester wiederum übersetzt die Lehren Carlos Castañedas in performative Gesten, Neda Saeedi baut Säulen aus ausgestorbenen Pflanzen und balanciert darauf einen nachtblauen Hexenthron. Er entpuppt sich als Modell eines Stuhls aus dem EU-Parlament.
Laut Kuratorin Nina Tabassomi bilden die „Hexen“ den Auftakt zu einer Ausstellungstrilogie, die sich als nächstes mit „Göttinnen“ beschäftigen will. Dann wohl schon in Tabassomis zweiter Amtszeit als Direktorin der Kunsthalle Tirol im Taxispalais, ihr Ende 2021 auslaufender Vertrag wird um weitere fünf Jahre verlängert.
26.06 - 03.10.2021
Taxispalais Kunsthalle Tirol
6020 Innsbruck, Maria-Theresien-Str. 45
Tel: +43 512 594 89 401
Email: info@taxispalais.at
http://www.taxispalais.art
Öffnungszeiten: Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr


 Teilen
Teilen