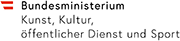Rainer Metzger,
Das Geheimnis der Liebe
Nun haben sie sie alle ganz liebgewonnen, die Grazer ihre An-, Um- und Einbauten, die ihnen die Kulturhauptstadt das Jahr über beschert hat. Sie haben sich auf die Mur-Insel auf einen Cappuccino gesetzt, sind 50.000fach mit ihren Gästen den transparenten, einen Euro teuren Schacht zur Madonna hoch gefahren und haben auf den Schatten des Körpers des Uhrturms geblinzelt, der ihnen über der Stadtkrone hing. Peter Pakesch hat in seiner Wahrnehmungs-Schau im Kunsthaus gar eine spezielle Hommage untergebracht und auf jenen Rüssel hin, der sich Markus Wilflings nachtschwarzem Doppelgänger entgegensaugt, eine Arbeit von Anthony Caro platziert, die da heißt: "Shadow". Keine Frage, der Vertrag zwischen Kunst und Kundschaft zur gegenseitigen Nutzung der Hingabewerkzeuge hat funktioniert.
Nun neigen die menschlichen Dinge von vornherein dazu, sich zu verstetigen. So sind im Laufe der Jahrtausende aus kurzfristigen Ehrenpforten steinerne Triumphbögen geworden, aus Wanderschauspielern fixe Ensembles und aus zarten Pflänzchen der Subkultur das Quartier 21. Und so werden auch aus den Grazer Mobilien Immobilien werden. Acconcis Eiland wird vom Stadtrat persönlich fest verankert, Kriesches Kletterglas trägt sich dank der Eintrittspreise buchstäblich selber, und auf Wilflings Schattengewächs wird auch gerade mit neuer Emphase geblickt. Zwar soll die Konstruktion demnächst ein Einkaufszentrum zieren, nicht mehr dunkel, sondern bemalt wie das Original, doch die berühmte Initiative, die zur Erhaltung und zum Respekt und zum Status Quo aufruft, ist längst aktiv. "Das Kunstwerk entfernen, bedeutet, es zu zerstören", sagte Richard Serra, als sie ihm seinen "Tilted Arc" aus New York wegholten. Wie wahr.
Warum das alles so ist, hat einst Walter Benjamin beschrieben, in seinem Kunstwerk-Aufsatz von 1936, wo es also heißt: "Die taktile Rezeption erfolgt nicht sowohl auf dem Wege der Aufmerksamkeit als auf dem der Gewohnheit. Der Architektur gegenüber bestimmt diese letztere weitgehend sogar die optische Rezeption. Auch sie findet von Hause aus viel weniger in einem gespannten Aufmerken als in einem beiläufigen Bemerken statt. Diese an der Architektur gebildete Rezeption hat aber unter gewissen Umständen kanonischen Wert. Denn: Die Aufgaben, welche in geschichtlichen Wendezeiten dem menschlichen Wahrnehmungsapparat gestellt werden, sind auf dem Wege der bloßen Optik, also der Kontemplation, nicht zu lösen. Sie werden allmählich nach Anleitung der taktilen Rezeption, durch Gewöhnung, bewältigt." Das Geheimnis der Liebe: Man gewöhnt sich aneinander. In Graz wissen sie es mittlerweile auch.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger 

 Teilen
Teilen