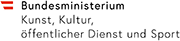Simplificissimus
An Ephraim Kishon können sich nur wenige erinnern. Noch weniger an seine mit Sarkasmus gespickten Bemerkungen zur bildenden Kunst. Das ist auch gut so. Nicht selten wähnen sich Humoristen auf der richtigen Seite, wenn sie meinen, Wahrheiten aussprechen zu dürfen, die andere entweder nicht sehen oder sich nicht zu benennen trauen. Und doch können sie in die Falle tappen, die sie glauben zu entdecken. Kishons Buch: “Picasso war kein Scharlatan” (1985) war nicht nur dank der leichten Lesbarkeit ein Verkaufsschlager. Seine These unterwarf sich hemmungsfrei der Vereinfachung. Während andere so genannte “moderne” Künstler unfähig waren, sei Picasso die Ausnahme gewesen. “Wenn er gewollt hätte, hätte er wie Giotto oder Tizian malen können”, schrieb Kishon. “Doch er wollte nicht. Das heißt, er wollte nur so lange, bis er das große Prinzip verstanden hatte, daß die Menschen keine eigene Meinung haben (...)”. Als besonderes Possenspiel darf dabei gewertet werden, dass Kishon von derselben Annahme ausging wie Theodor W. Adorno. Kishon entdeckte in Picasso den Verblendungszusammenhang der Moderne. Adorno hatte gemeint, dass in der Moderne zur Selbstverständlichkeit geworden war, dass an ihr nichts mehr selbstverständlich war. Er benannte damit den brüchigen Boden einer von Verunglimpfung überschatteten Kunst. An ihr ist nichts geistlose Floskel. Während sich der Philosoph deshalb bedingungslos und in tiefem Ernst der Abstraktion verschrieb, meinte Kishon, wenn nichts mehr selbstverständlich ist, dann muss selbst die ernsthafte Kunst zu einer Art Satire werden. Formuliert wird dies in Aphorismen wie: “Warum den guten Leuten nicht eine Frau mit zwei Nasen oder zwei Frauen mit einer Nase liefern, wenn sie das gerne möchten.” Das falsche Leben mit falschen Antworten zu spiegeln, ist Kishons Antwort. Gewitzt ist der Gedanke zwar, aber er diskriminiert alle Kunst zur verächtlichen Praxis und das seriöse Denken noch mit dazu.
Eine Schweizer Finanzberatung, die unter anderem Niederlassungen in Liechtenstein und Feldkirch unterhält, inserierte in der Oktober-Ausgabe eines Kunstmagazins, herausgegeben vom Kunsthaus Zürich. In dieser Anzeige wird das Spiel um die Abstraktion nochmals aufgenommen. Ein fiktives Picasso-Gemälde wird gezeigt, ein Portrait einer Dame in blauem Kostüm mit Absinth-Glas und Perlenkette. Es vermittelt die charakteristischen Merkmale kubistischer Formverschiebung. Die Parodie wird nicht verborgen. Schultern und Arme der Dame sind kantig, das Gesicht besteht aus geschwollenen Lappen, die Finger gleichen gestopften Stoffpuppen. Hinter ihr zerfällt der Raum aus blassem Grau. Der Kubismus ist die unbeholfene, verschrobene Kunst. Daneben rechts befindet sich das Vergleichsbild. Es ist eine Art flurbereinigte, zurechtgerückte Abstraktion. Ein Rückwärtsgang in die Normalität. Man möchte dieses Gemälde für das Vorbild, die Vorlage für die kubistische Verzerrung nehmen, wäre da nicht im Textfeld die Irritation, die dieses Verhältnis neuerlich umkehrt. “Finanzberatung muss nicht abstrakt sein.” Doch wer Denken vereinfacht, der gefährdet sein Anliegen, ob nun mit Humor gewürzt oder nicht.
 Mehr Texte von Thomas D. Trummer
Mehr Texte von Thomas D. Trummer 

 Teilen
Teilen