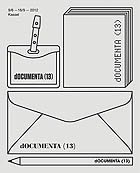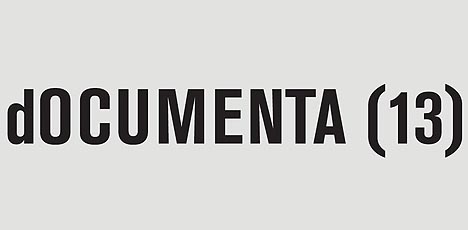
Vitus Weh,
Typografien des Kunstbetriebs: Sind die Corporate Identities der Zukunft polymorph?
Als Speerspitze neoliberalen Wirtschaftens gilt der Kunstbetrieb aufgrund seiner „informellen“ Anstellungs- und Entlohnungsmodalitäten, Stichwort Prekariat, bereits seit längerem. Doch möglicherweise gibt es noch ein anderes Spielfeld des modernen Unternehmertums, in dem dem avancierten Kunstbetrieb eine Avantgardefunktion zukommt, jenem der Corporate Identity (CI).
In der Kritik und in der Bearbeitung durch den Kunstbetrieb steht der moderne Logo-Kult bereits seit längerem: Im Jahr 2000 erschien Naomi Kleins Bestseller „No Logo““, in dem die Globalisierung von Marken und die unheilvolle Entwicklung von klassischen, produzierenden Herstellerfirmen hin zu Lifestyle-Vermarktungsunternehmen, also reinen Logofirmen, analysiert wird. Bereits kurz davor (September 99) ging die Kasseler Großausstellung Documenta11 mit einem dezidierten non-Logo-Konzept des Künstlers Ecke Bonk an den Start. Doch der „unterkühlte Briefkopf“ (Bonk) konnte sich 2002 dem Logo-Gebrauch und der Merchandise-Nutzung ebenso wenig entziehen wie 2007 die wunderbar lapidare Strichelliste der documenta 12 (Entwurf: Martha Stutteregger), Nun liegen die Gestaltungspläne für die 13. Documenta-Ausgabe vor. Wie es scheint, versucht man es mit einer anderen Strategie: Die CI wird polymorph.
Erfunden wurde die Gestaltungsaufgabe „Unternehmenserscheinung“ bereits vor rund 100 Jahren. Peter Behrens führte zwischen 1907 und 1914 als künstlerischer Berater der Firma AEG zum ersten Mal ein einheitliches Erscheinungsbild („Logotype“) ein. Schrift funktioniert dabei wie Magie: Sie teilt nicht nur die Information eines Wortes mit, sondern vermittelt mit ihrer Typografie auch eine unterschwellige Botschaft. Um uns zu verzaubern, lassen große Firmen oder Institutionen daher oft spezielle Schriften entwerfen. Man vergleiche die Logomarken von Coca Cola und Daimler Benz: Die eine Schrift ist beschwingt, die andere seriös und breitspurig – genau wie das Bild, das man vom jeweiligen Produkt haben soll. Damit dieses Imago möglichst niemals wackelt und die Zeit überdauert, ist jede denkbare Anwendungsmöglichkeit in so genannten CI-Manuals festgelegt. Bei Firmen wie IBM (das ab 1956 verwendete IBM-Logo stammt von Paul Rand) erstreckt sich die CI selbst auf Krawatten und Firmenhymnen. Alles soll eindeutig und wie aus einem Guss erscheinen.
Gegenüber solcher Homogenität erscheint eine forcierte Vielgestaltigkeit zunächst als starker Kontrast. Tatsächlich zielt die Perspektive, die von Seiten avancierter Kunstinstitutionen seit einiger Zeit durchdekliniert wird, auf Immanenz und Performanz. Aus dem Bereich der Kunstvereine war der irisierende Wechsel bereits bekannt: Sobald ein Haus eine neue künstlerische Leitung bekam, wurde auch die CI geändert. Manche Institutionen durchliefen dadurch – trotz gleich bleibendem Vorstand und Haus – in einem Jahrzehnt mitunter vier äußerlich komplette Identitätswechsel. Bei Museen war dies jedoch anders. Da setzte man, dem Sammlungs- und Bewahrungsimperativ folgend, auf Kontinuität. Man verwendete vornehmlich Antiqua-Schriften, Schriften wie für ewig in Stein gemeißelt, die nahtlos die Antike über den Barock, den Klassizismus bis zur Jetztzeit überbrücken. In der traditionsreichen Wiener Albertina hat man sich für solch eine Schriftmarke (Gestaltung: Fidel Peugeot / Christian Satek) beispielsweise noch im Jahr 2003 entschieden.
Eine der ersten Institutionen, die auf eine ganz andere Art der Schriftgestaltung setzte, war das Walker Art Center in Minniapolis, USA. Die in ihren Grundzügen heute noch benutzte CI-Schrift datiert aus dem Jahr 1995, heißt Walker und stammt von Matthew Carter. Das besondere an ihr: Sie ist fett, dynamisch und variabel. Weiter wegweisend wurde die Schriftmarke, die die Agentur Wolff Olins im Jahr 2000 für die Londoner Tate modern entwickelte: ein sich ständig bewegendes Schattenbild einer Schrift, das auch ein unsauber gesprühtes Stencil, also temporäre Street Art, sein könnte. Ähnlich hat auch das Münchner hausderkunst seine Schrift mittlerweile aufgelöst in viele kleine Punkte (Entwurf: Mischa Leiner, 2004), die an leuchtende Glühbirnen im Zirkus, Varieté oder Kino erinnern, und damit auch an die Vorstellung vom Museum als fun palace.
Nun, 2010, hat die documenta nachgezogen. Die neue Gestaltung stammt von der italienischen Agentur Leftloft. Die Schreibweise „dOCUMENTA (13)“ ist dabei, anders als bisherige Logos, nicht auf einen einzigen Schrifttyp beschränkt. Unterschiedlichen Objekt-Typen sollen erstmals unterschiedliche Schriftarten zugeordnet werden. „Die wahre Identität der documenta kann als die Summe von vielen unterschiedlichen Zeichen und Bedeutungen beschrieben werden,“ so die Agentur. Sie sollte daher nicht auf ein spezifisches Grafikdesign reduziert werden. Man wolle mit dieser Gestaltung eine „lebendige, pluralistische, ideenreiche und stetig zunehmende Entwicklung in Gang setzen“. Interessant ist auch der Kommentar der documenta-Leiterin Carolyn Christov-Bakargiev: Während die Kleinschreibung in ihren Anfängen „eine radikale demokratische Geste“ war, ist heute die Nicht-Großschreibung „eine von vielen unbeabsichtigten Gesten der digitalen Welt“. Die normalen Schreibregeln umzudrehen, indem man das restliche Wort in Großbuchstaben schreibt, erfordere „aktives Engagement, Aufmerksamkeit und einen gewissen Mehraufwand an der Tastatur“.
Man darf gespannt sein, was von diesen theoretischen Überlegungen in der Praxis des Ausstellungsevents Bestand haben wird. Ganz offensichtlich bemüht man sich, eine Vielfalt an Perspektiven nicht nur zu fordern oder anzustreben, sondern von Beginn an zu visualisieren. Das ist überaus erfreulich und übersetzt möglicherweise die Intentionen, die die politische Philosophie mit dem Begriff der Multitude verbindet, in eine einleuchtende Form. Die Hybridisierung der Identität könnte sich aber auch als ein weiterer Schritt in Richtung ökonomischer Flexibilisierung herausstellen. Was die pluralistische Schriftenvielfalt der documenta 13 dann wirklich von den Strategien der Multi-Brand-Konzerne unterscheidet, wird man sich genau anzuschauen haben. Vielleicht erweist sich die neue Gestaltung trotz seiner Manieriertheit als ein Symbol der Potenzialität, vielleicht aber auch als eines der affirmierten Haltlosigkeit. Eines ist jedoch bereits gewiss: Ab jetzt gehören im Kunstbetrieb nicht mehr nur die Mitarbeiter, sondern auch die Logos zum Prekariat.
 Mehr Texte von Vitus Weh
Mehr Texte von Vitus Weh
 Mehr Texte von Vitus Weh
Mehr Texte von Vitus Weh 

 Teilen
Teilen