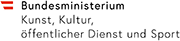Linke und rechte Kulturpolitik
Die Kultursprecherin der Sozialdemokratischen Partei Österreichs hatte zu einem runden Tisch ins Bruno-Kreisky-Forum geladen. Diskutiert werden sollte die Frage: „Was ist linke Kulturpolitik.“ Gekommen waren dreißig Kulturschaffende aus allen Sparten, als Ausgangspunkt wurde der Begriff der „partizipativen Kunst“ in die Runde geworfen, man konnte sich auf einen spannenden Abend freuen.
Erwartbarerweise überwiegten zuerst die Stimmen, die es sich strikt verbaten, die Kunst mit einem irgendwie gearteten Auftrag zu versehen. Kunst dürfe alles und müsse nichts, schon gar nicht links oder partizipativ sein. Einer meinte, dass Kunst vor allem radikal und subversiv zu sein habe, ein anderer wiederum, dass der Kunstbetrieb mit seinen Selektionsverfahren, seiner Preispolitik und seinem Hang zur Repräsentation doch wohl per se eher rechts sei. Daraufhin meldeten sich einige Maler und Radiomacher: Der Akt des Kunst- und Kulturschaffens selbst sei doch eine lustvolle Könnenserfahrung, man fühle sich frei, artikuliere sich und stärke das Selbstwertgefühl. Solch eine Praxis zu fördern, das sei linke Kulturpolitik. Zu einem Konsens kam es an diesem Abend nicht mehr: Die Vorstellungen von einer linken oder rechten Kulturpolitik schienen sich merkwürdigerweise ständig zu überlagern.
In der Hoffnung, meine solcherart verwirrten Positionen im Kopf etwas klären zu können, besuchte ich einige Tage später den “Kampf um die Stadt” im Wiener Künstlerhaus. „Kampf um die Stadt“ ist eine vom Wien Museum konzipierte Großausstellung, die sich mit der Umbruchzeit zwischen 1918 und 1938 beschäftigt. Damals stand ein „Rotes Wien“ gegen eine „schwarze Alpenrepublik“, Asphalt stand gegen Scholle, Großstadtkultur gegen Volkstumsideologie. Ich dachte, wenn sich die politischen Lager derart polarisierten, müsste doch auch die Kulturpolitik klare Konturen gehabt haben.
Die Ausstellung ist in der Tat eine gut orchestrierte Zeitgeist-Maschine: Themenfelder wie Autoverkehr und Alpenideologie, Bürgerkrieg und Ständestaat, Arbeitslosigkeit und Freizeitkultur, Architektur, Design und Mode öffnen weite Fenster, aus denen den Besuchern die Stimmungen, die Töne und Parolen, die Körperhaltungen und Frisuren, die Not und das Vergnügen der damaligen Welt entgegen wehen. Auch die Kunst und Kulturpolitik jener Zeit ist solch ein Themenfeld. Erstaunlicherweise ist es jedoch das einzige, in dem die Ausstellung keinen wesentlichen Konflikt zu erzählen weiß: Kulturpolitik im heutigen Sinne gab es kaum, weder von links noch von rechts, und das wenige ähnelte sich. Sicher: die „linke Kulturpolitik“ förderte unter anderem Arbeiter-Symphoniekonzerte, die „rechte“ vermehrt Künstler, die die Heimatideologie stärkten. Ansonsten jedoch sahen sich die Sozialdemokraten eher dem Vorwurf ausgesetzt, in punkto Kultur mit den Bürgerlichen wettzueifern – z.B. in dem sie die Wiener Festwochen etablierten.
Die Ausstellung präsentiert das Kapitel dem entsprechend wie in einem Kunstmuseum: Man wird aus der spezifischen Zeit herausgekippt und steht plötzlich vor einzelnen Werken. Die Bilder und Skulpturen sind hier nicht mehr wie im Rest der Schau dokumentarisch illustrativ eingesetzt, sondern überzeitlich und autonom gemeint. Im Rahmen der ansonsten aufklärerisch-debattierenden Präsentation bleibt das Kapitel auf symptomatische Weise ein Fremdkörper.
Ein tendenzielles Instrumentarium wird Kulturpolitik erst, wenn man den Rahmen der ästhetischen Gestaltung weiter steckt. Dann manifestierte sich die sozialdemokratische Kulturpolitik in den 1920er Jahren nämlich vor allem als sozialer Wohnbau. Diverse Luxus- und Vergnügungssteuern ermöglichten gewaltige Bauleistungen. Über die ganze Stadt verstreut wuchsen eindrucksvolle burgartige Wohnanlagen mit wegweisenden familiengerechten Einrichtungen. Die „rechte Kulturpolitik“ ab 1934 hingegen errichtete als größten Repräsentationsbau des Ständestaates die kurvenreiche Höhenstraße, von der man aus der Ferne das schöne Wien betrachten konnte. Intendiert war sie als Inszenierung der Fahr- und Schaufreude für die Oberschicht und als Impuls für den Wien-Tourismus. Vielleicht, so dachte ich, sollte man genau solche Beispiele als paradigmatisch nehmen für linke und rechte Kulturpolitik: Auf der einen Seite werden würdevolle Orte für untere und mittlere Schichten geschaffen, auf der Seite wird die distanzierte Rezeption gefördert.
Beim bevorstehenden Neubau des Wien Museums wird es in diesem Sinne interessant sein, ob nur auf eine eindrucksvolle Architektur und großzügige Ausstellungshallen geachtet wird, oder auch auf ein Raumprogramm, das Anknüpfungspunkte für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen bietet, also z.B. Workshop-Räume für Jugendliche und MigrantInnen, oder Spielcafés für Familien mit Kinder, ein kostengünstiger freier Veranstaltungsraum usw. Daran wird sich zeigen, wie „links“ oder „rechts“ die Wiener Kulturpolitik heute ist.
 Mehr Texte von Vitus Weh
Mehr Texte von Vitus Weh 

 Teilen
Teilen